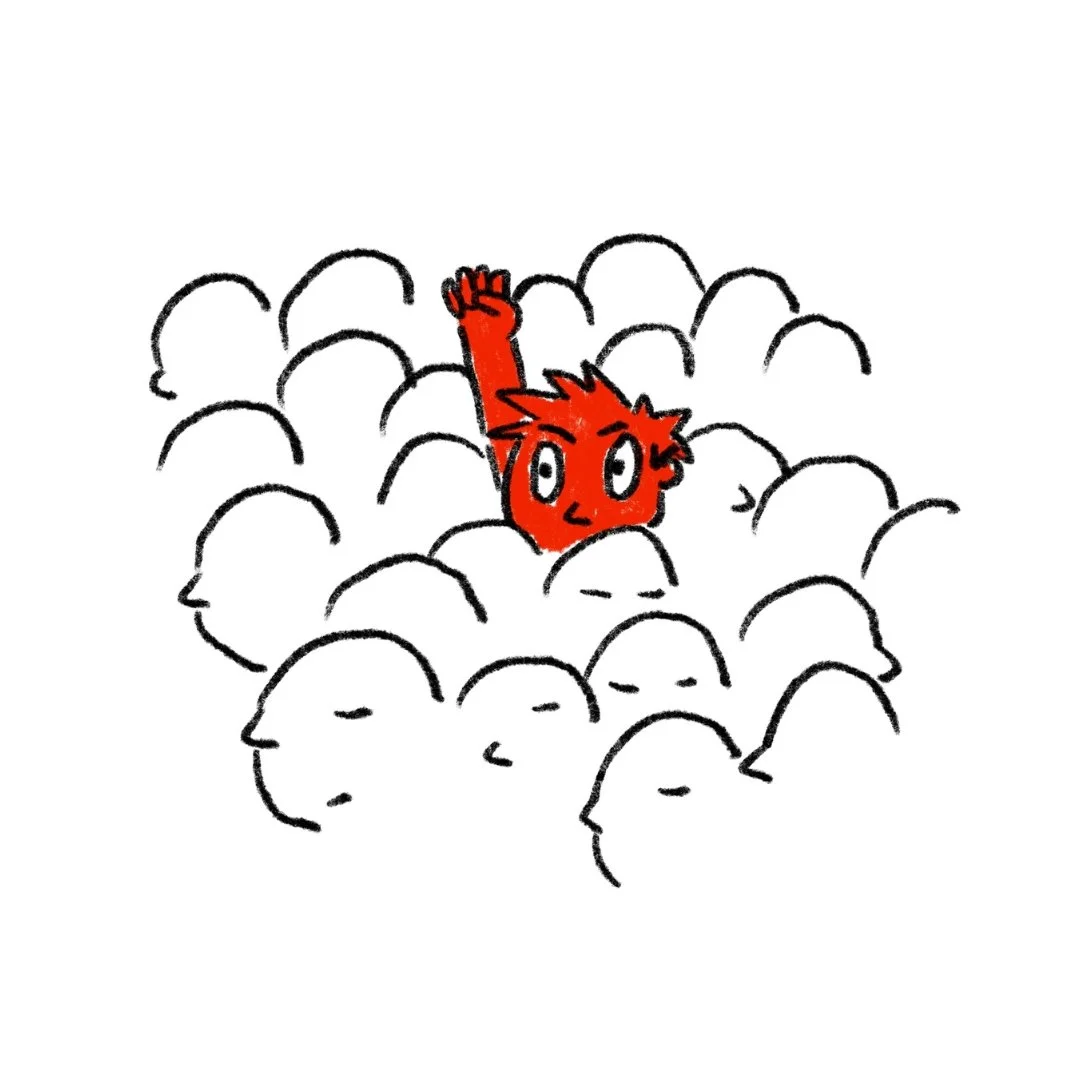Repräsentation
Verschwinden für Anfänger.
Es war ein Vorstellungsgespräch, das mich in der Erde versinken ließ. Dabei ging es um einen lächerlich kleinen Job in der Redaktion einer Lokalzeitung. Ich hatte während meines Studiums ein paar Jahre für die Kulturseite der Hildesheimer Allgemeinen gearbeitet. Musical-Revue in der Sparkassen-Arena, kotzende Performance-Künstler im Theaterhaus, Punkkonzerte in der Kulturfabrik. Ich hatte meine Texte gegen 12 Uhr mittags abgegeben. Zuverlässig. Selbst, nachdem ich mitbekommen hatte, dass die Kulturredakteurin meine 90 Zeilen erst gegen Feierabend in die vorbereitete Seite kopierte.
So erreichte mich dieses Jobangebot, Wochenendvertretung. Ich nahm an der Tür Platz, in einem kleinen Büroraum, der nach Altpapier roch. Ein Redakteur, bekannt für seine kritische Begleitung der Parkplatzsituation, fragte mich, wo ich herkäme, was ich so machte. Eine Viertelstunde, dann ging ich wieder. Am nächsten Tag rief mich die Kulturredakteurin an. Ihre Stimme klang mütterlich enttäuscht. Das mit dem Wochenenddienst werde wohl nichts, seufzte sie. Der Lokalredakteur habe gesagt, ich sehe aus „wie drogensüchtig“. Und ein bisschen Repräsentation müsse sein, auch am Wochenende. An diesen Satz erinnere ich mich Wort für Wort, als hätte ich ihn im Dunkel eines Theatersaals in meinen Notizblock geritzt: „Ein bisschen Repräsentation muss sein.“
***
Tatsächlich war ich einfach ein Langzeitstudent. Mein Hemd war wahrscheinlich nicht gründlich gebügelt, wenn überhaupt. Und ich habe schwere Neurodermitis. Im Bluttest weist mein Gesamt-IgE-Wert, der die Anfälligkeit für Allergien misst, 929 kU/l aus (beinahe das Zehnfache des Normwerts). Und in den Pricktests meiner Kindheit – wenn zittrige Auszubildende mir kleine Tropfen mit Allergenen auf den Unterarm setzten und mit einer Lanzette in die Haut stachen – schwoll die weiche Innenseite meines Unterarms zuverlässig an. Baumpollen, Gräser- und Kräuterpollen, Haustaubmilben und Schimmelpilze. Alles Rot. Bis hinauf zu meiner Armbeuge, die ohnehin gerötet war. Und so sah meine Haut aus. Im Frühjahr und Sommer, weil die Pollen flogen. Und im Winter, weil die Heizungen bollerten. Wobei besonders stark „die exponierten Hautstellen“ betroffen waren, wie die Unikliniken in ihren Berichten festhielten. An den Händen und im Gesicht. Überall, wo der Lokalredakteur (und jede und jeder, der sich am Wochenende in die Redaktion verlaufen hätte) mich sehen konnte.
„In den Pricktests meiner Kindheit – wenn zittrige Auszubildende mir kleine Tropfen mit Allergenen auf den Unterarm setzten und mit einer Lanzette in die Haut stachen – schwoll die weiche Innenseite meines Unterarms zuverlässig an. Baumpollen, Gräser- und Kräuterpollen, Haustaubmilben und Schimmelpilze. Alles Rot. “
Nun bin ich mit meinen Hautrötungen nicht allein. In Deutschland haben rund 10 Millionen Menschen eine chronische sichtbare Hauterkrankung, am weitesten verbreitet sind Akne, Rosazea, Neurodermitis und Psoriasis. Diese Menschen begegnen uns jeden Tag. In der S-Bahn, an der Supermarktkasse, im Büro.
Und viele dieser Menschen leiden, wie ich, nicht nur unter gesundheitlichen Einschränkungen, sondern auch unter begleitenden sozialen und psychischen Belastungen. So ergab eine Studie unter ambulant betreuten dermatologischen Patientinnen und Patienten in 13 europäischen Ländern, dass diese ungewöhnlich häufig von Depressionen, Angststörungen und Selbstmordgedanken betroffen sind. Dies trifft Menschen am härtesten, die besonders vulnerabel sind. Es kommt zu einer „kumulativen Beeinträchtigung der Lebensqualität“, wie Forschende schreiben.
***
Im Jahr 2014 rief die Weltgesundheitsorganisation in einer Resolution ihre Mitgliedsländer auf, für die Erkrankung der Psoriasis und ihre Stigmatisierung zu sensibilisieren. Eine Gruppe aus Medizinern und Versorgungsforschern u.a. am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) stellte daraufhin einen Antrag beim Bundesgesundheitsministerium, um Maßnahmen zu evaluieren, die der Stigmatisierung entgegenwirken könnten. Es folgte zunächst eine Ablehnung. Die Begründung des Ministeriums: Erstens sei die WHO-Resolution nicht bindend. Und zweitens: In Deutschland werde nicht stigmatisiert. Wenn Rachel Sommer, Versorgungsforscherin am UKE, heute davon berichtet, liegt noch immer Erstaunen in ihrer Stimme. „In der Folge hat unser Institut mehrere Forsa-Umfragen in Auftrag gegeben“, sagt sie. Später auch mit einer Finanzierung des Bundesgesundheitsministeriums, das das dreijährige Projekt “ECHT” förderte.
„Jede fünfte Person in Deutschland, die Diskriminierung von Menschen mit sichtbaren Hauterkrankungen beobachtet hat, hat diese am Arbeitsplatz (21%) oder im öffentlichen Raum (18%) miterlebt.“
Und es stellte sich heraus: In Deutschland wird stigmatisiert. Die Ergebnisse der repräsentativen Umfragen variierten vor allem, je nachdem, wie die Menschen befragt wurden. Wurden die Menschen indirekt befragt, wie bei Themen üblich, wo soziale Erwünschtheit eine Rolle spielt, fielen die Ergebnisse drastischer aus. 2018 gaben 69% der Befragten in einer repräsentativen Umfrage an, die Mehrheit der Bevölkerung finde Menschen mit Psoriasis „ekelhaft“. 45% glaubten, die allgemeine Wahrnehmung sei, die Erkrankten müssten sich besser um ihre Körperhygiene kümmern.
Diese Vorurteile betreffen auch andere Menschen mit sichtbaren Hauterkrankungen wie Akne, Rosacea, Psoriasis oder Neurodermitis. Menschen mit Hautrötungen und -veränderungen werden einer breiten Studienlage zufolge systematisch benachteiligt. Sie werden als weniger vertrauenswürdig eingeschätzt, haben in Gehalts- und Einstellungsgesprächen schlechtere Chancen, bekommen als Schülerinnen und Schüler schlechtere Noten und werden generell als weniger intelligent wahrgenommen.
***
Was all das mit struktureller Diskriminierung zu tun hat, lässt sich absurderweise an der Kommunikation des Berufsverband der Deutscher Dermatologen (BVDD) nachzeichnen, der das Projekt “ECHT” mit ins Leben rief. „ECHT“ steht für „Entstigmatisierung von Menschen mit sichtbaren chronischen Hauterkrankungen“. In einer Sonderanzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Dezember 2018 stellte Sophia Schlette, damals Leiterin der politischen Kommunikation und später Geschäftsführerin des BVDD, das “Entstigmatisierungsprojekt” mit diesem Teaser vor. “Menschen, denen ihre Krankheit anzusehen ist, leben in einem von der Norm abweichenden Körper: Sie haben Hautprobleme oder sind unförmig, ihnen fehlen Gliedmaßen, oder sie sitzen im Rollstuhl. Die Betroffenen können sich den Blicken anderer kaum entziehen und leiden unter der Stigmatisierung.” Menschen mit sichtbaren Hauterkrankungen seien “gefangen in der eigenen Haut, gefangen im eigenen Körper”. Die Sonderanzeige war mit einem Stockfoto von schwarzen Schafen bebildert. Eine Entstigmatisierungskampagne, finanziert durch das Bundesgesundheitsministerium, wird mit krassen ableistischen und rassistischen Klischees vorgestellt. Echt jetzt.
***
Mit Anfang Zwanzig erlebte ich, was diese tief verwurzelte Diskriminierung im Alltag bedeutet. Mein Gesicht war eine offene Wunde. Nachts schlief ich kaum. Und wenn ich in den Hörsaal kam, hatte ich das Gefühl, von Hunderten Studierenden der eine zu sein, der angestarrt wurde. Der anders war. Ich zog mich zurück, in ein winziges Zimmer im Studentenwohnheim. Bevor ich nach draußen ging, zum Einkaufen oder zum Arzt, atmete ich tief durch. Ich stützte mich auf ein Waschbecken, sah in den Spiegel. Ich sagte mir, dass ich das aushalten würde, also könnten es die anderen auch. Aber konnten sie das?
Menschen sprachen mich an der Supermarktkasse oder im Wartezimmer an, um mir medizinische Ratschläge zu geben. In der Regel ging es um Nachtkerzenöl oder Aloe Vera. Manchmal darum, zu entschlacken. Andere hatten das dringliche Bedürfnis mir ins verwundete Gesicht zu seufzen: Jaa, die Haut ist der Spiegel der Seele. Das kam nicht einmal vor, sondern in schöner Regelmäßigkeit. Wieder andere sahen auf den Boden, wenn sie mir begegneten, wichen aus, setzten sich weg. Manche beschimpften mich auf offener Straße. Neuer Mantel? Siehst trotzdem scheiße aus.
Nach zwei Semestern im körperlichen Ausnahmezustand wurde ich in eine stationäre Hautklinik überwiesen. Dreimal am Tag stellten die Pflegekräfte kleine Tiegel mit Cortison-Creme an mein Bett. Und mit der Creme legte sich eine Leichtigkeit über meinen Körper. Ich erlebte dieses leicht euphorisierende Verdunsten von Betamethason über der Haut. Ich wünschte, aus meiner Haut schlüpfen, unsichtbar sein zu können. Und während meine Wunden heilten und sich der Fibrinbelag in leichten Bahnen löste, hatte ich, wie manchmal beim Tapete-Abziehen, das Gefühl einen glücklichen Anfang gefunden haben. Ich sah in den Spiegel, und ich sah mein Gesicht. Und ich empfand das als solches Glück, dass ich mir schwor, wenn ich nur gesund genug wäre, um im Alltag nicht mehr aufzufallen – dann wäre ich glücklich.
***
Ich habe in den folgenden Jahren gelernt, auf meinen Körper zu achten, sensibel mit mir umzugehen. Während meine Freundinnen und Freunde auf Festivals fuhren, um zwischen Bierkästen zu campen und mit synthetischen Amphetaminen zu experimentieren, wurde ich von Zeit zu Zeit in die Hautklinik eingewiesen. Gerne im Februar, wenn die Haselnusspollen in die Heizungsluft zogen. Eine Allergologin brachte mir bei, mein Alltagsleben in seine Einzelteile zu zerlegen. Bei gedünsteten Möhren anzufangen, dann Brokkoli, dann Kartoffeln. Ich lernte, meinem Körper nachzuspüren, während andere ein Semester in Lissabon verbrachten. Das leichte Kribbeln auf der Zunge, die fliegende Röte vom Kehlkopf zum Ohr. Welche Pullover fühlten sich gut an? Welche Cremes waren reichhaltig genug? Auf welcher Handseife stand sensitiv, und welche roch wirklich nach nichts? Es kamen neue Schübe, die mir ins Gesicht peitschten, mich in wechselnde Kliniken brachten. Von beengten Altbauten in komplexe Baukastenbauten am Stadtrand. Langsam legte sich das Grundrauschen meines Immunsystems, die Schübe ebbten ab. Allergien schälten sich heraus, auch manche, die sich im Erwachsenenalter gewöhnlich verlieren. Kuhmilch, Eier, Petersilie.
Seitdem kann ich auch leider keinen Alkohol mehr trinken. (Nein, nicht einmal zum Anstoßen, Frau Kienzle.) Und wenn ich es doch versuche (ein Selbstexperiment, dass ich alle zwei, drei Jahre einmal an Küchentischen durchführe, um Freunden zu zeigen, dass ich wirklich keinen Alkohol trinken sollte) dann schwellen meine Lippen an, meine Wangen beginnen zu glühen, und mein Gesicht nimmt das fleckige, tiefe Rot eines verschütteten Bordeaux‘ an.
***
Am Ende des Studiums, während meine Kommiliton*innen sich von Praktikumsplatz zu Praktikumsplatz hangelten, in Durchgangszimmern schliefen – von Hamburg nach Berlin – war ich in Hildesheim unterwegs. Für die Lokalzeitung zog ich durch Blues-Bars und Off-Theater, ich durfte Freundinnen zu Konzerten mitnehmen. Die Leute hinter der Bar kannten mich, Theatermenschen in pinken Trainingsjacken, Vereinsvorsitzende, Konzertveranstalter mit Wolfgang-Petry-Locken. Ich wurde umgarnt, verlacht, gehasst. Performancekünstler schrien mich an, Jazzmusiker schrieben hasserfüllte Leserbriefe. Ich gehörte dazu, irgendwie – auch, wenn ich in der letzten Reihe saß und während der Zugabe rausschlich. Ich musste nachts einen Anfang Ende finden, am nächsten Morgen ein Ende. Und um zwölf Uhr raus damit. Ich zog mir die Sprache des Feuilletons über, wie einen zu großen Mantel. Ich konnte darin verschwinden, irgendwie.
„In der medizinischen Literatur wird Diskriminierung von chronisch erkrankten Menschen häufig behandelt, als wäre sie der Krankheit immanent. Das ist falsch. Die Marginalisierung steckt in unserer Kultur, in den Institutionen, in unseren Köpfen und Körpern.“
Einmal fragte ich Rachel Sommer, die Versorgungsforscherin am UKE in Hamburg, ob sie sich nicht eine größere Öffentlichkeit für die Ergebnisse ihrer Studien wünschte. Ist es nicht berichtenswert, dass Menschen mit sichtbaren Hauterkrankungen in diesem Ausmaß Diskriminierung erfahren? Rachel Sommer dachte einen Augenblick nach. Dann antwortete sie, ihrer Erfahrung nach interessiere das Thema über Fachzeitschriften hinaus nur wenige Medien. Auch, wenn in den letzten Jahren langsam das Interesse gestiegen sei, etwa in Hinblick auf die Themenwoche Haut, zu der auch öffentlich-rechtliche Sender wie ZDF und NDR berichteten. „Vielleicht”, sagte sie, “wird das Interesse größer, wenn Sie eine persönliche Geschichte erzählen.“
Aber wie geht das, unsichtbar? Seit einigen Jahren werde ich mit Dupilumab therapiert, einem antientzündlichen, immunsupprimierenden Wirkstoff, der in Fertigspritzen vertrieben wird. Alle zwei Wochen stoße ich mir eine zarte Nadel ins Unterhautfettgewebe am Bauch. Ein kleiner Stich, der allergische Reaktionen und Entzündungen der Haut abklingen lässt. Natürlich, ich bin weit entfernt davon, erscheinungsfrei zu sein. „Das Gesicht hinkt ein wenig hinterher“, wie eine Ärztin an der Uniklinik in Göttingen sagt. Und doch, wenn ich morgens in die S-Bahn steige – ein Mann im mittleren Alter, Hemd unter dem Pullover – gehe ich im Pulk der Pendelnden unter. Ich mache Öffentlichkeitsarbeit im sozialen Bereich, bereite Sätze für meine Kolleginnen und Kollegen vor. Meine Meldungen werden abgedruckt, ohne dass mein Name erscheint. Ich beantrage Fördermittel und organisiere Fototermine. Ich trete in den toten Winkel.
***
Was mir nicht gelungen ist, meine Biografie abzustreifen. Die Abwertung hört nicht auf, nur, weil ich sie nicht mehr alltäglich erlebe. In der medizinischen Literatur wird Diskriminierung von chronisch erkrankten Menschen häufig behandelt, als wäre sie der Krankheit immanent. Das ist falsch. Die Marginalisierung steckt in unserer Kultur, in den Institutionen, in unseren Köpfen und Körpern. Werbung und Medien zerlegen unsere Leben in Vorher-Nachher-Bilder. Um etwas zu verändern, müssen wir uns über die Definitionsmacht medizinischer Kategorien und Fremdbeschreibungen hinwegsetzen. Wie dies gelingen kann, zeigt die Behindertenrechtsbewegung, die Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen, Bedürfnissen und Talenten solidarisch zusammengebracht und über die Jahrzehnte Veränderungen erstritten hat. Nichts über uns, ohne uns.
Solange wir, chronisch kranke Menschen, die alltägliche Abwertung akzeptieren, wird es keine Akzeptanz geben. Wir dürfen uns mit unserem Vorher identifizieren, ohne die Symptome selbst hinzunehmen. Wir dürfen möglichst gesund sein wollen, und gleichzeitig für Menschen einstehen, die es im Augenblick nicht sind. Und, ja, wir sollten solidarisch sein und laut und sichtbar. Ein bisschen Repräsentation muss sein.
Quellen:
Weinberger, Natascha‐Alexandra, Sonja Mrowietz, Claudia Luck‐Sikorski, Regina Von Spreckelsen, Sven M. John, Rachel Sommer, Matthias Augustin, und Ulrich Mrowietz. „Effectiveness of a Structured Short Intervention against Stigmatisation in Chronic Visible Skin Diseases: Results of a Controlled Trial in Future Educators“. Health Expectations 24, Nr. 5 (Oktober 2021): 1790–1800. https://doi.org/10.1111/hex.13319.
World Health Organization (WHO). Psoriasis-Resolution, 13.5 WHA67.9 § (2014).
Sommer, R., J. Topp, U. Mrowietz, N. Zander, und M. Augustin. „Perception and Determinants of Stigmatization of People with Psoriasis in the German Population“. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 34, Nr. 12 (Dezember 2020): 2846–55. https://doi.org/10.1111/jdv.16436.
Topp, J., V. Andrees, N. A. Weinberger, I. Schäfer, R. Sommer, U. Mrowietz, C. Luck‐Sikorski, und M. Augustin. „Strategies to Reduce Stigma Related to Visible Chronic Skin Diseases: A Systematic Review“. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 33, Nr. 11 (November 2019): 2029–38. https://doi.org/10.1111/jdv.15734.