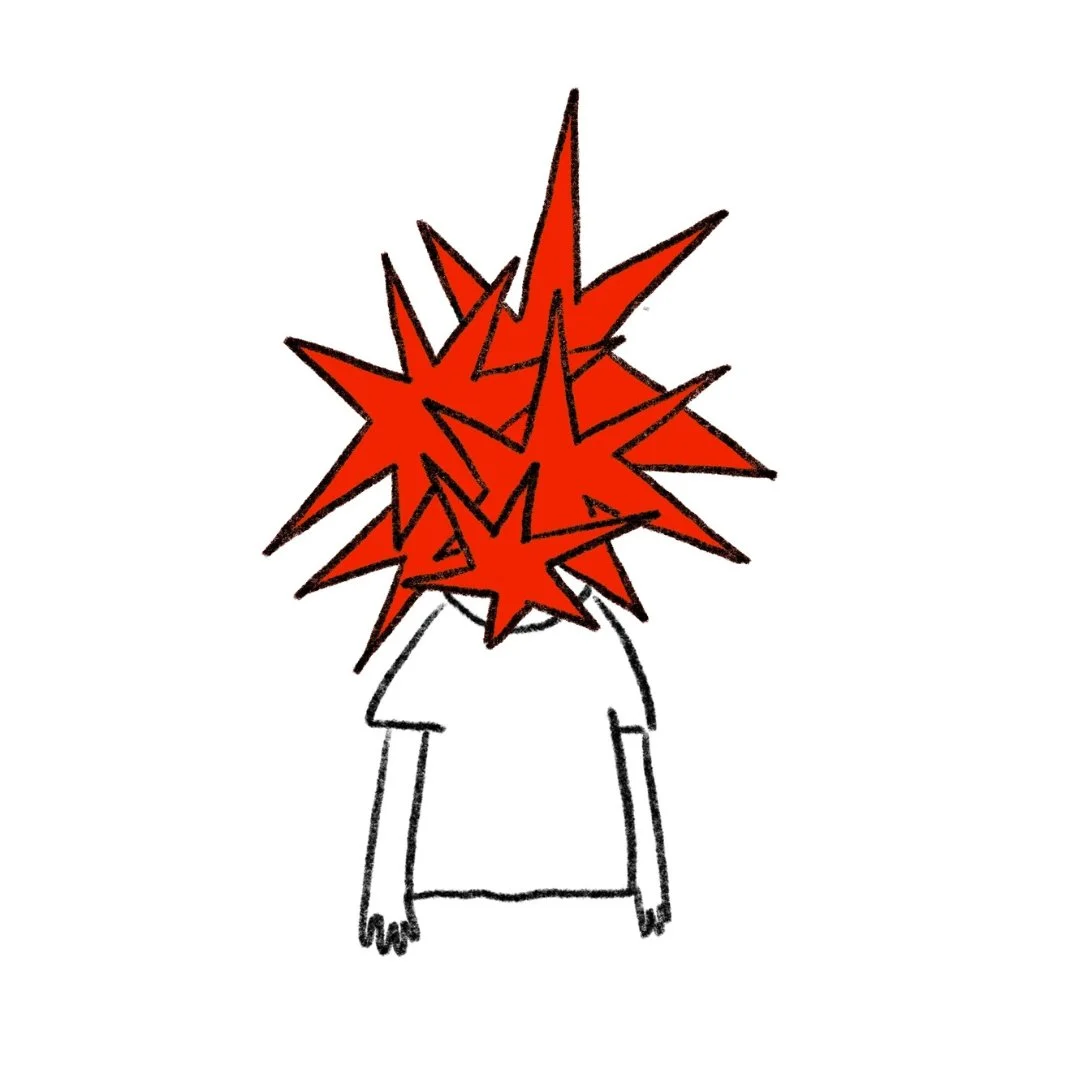Face Value
Über mediale Unsichtbarkeit.
Der Ausdruck Face Value bezeichnet laut Cambridge Dictionary den Wert, der auf Briefmarken oder Papiergeld ausgezeichnet ist. Die Redewendung at face value bedeutet, dass wir eine Information „für bare Münze“ nehmen, ohne ihren tatsächlichen Wert zu hinterfragen.
Wer die Website „Aktiv gegen Rosacea“ öffnet, könnte glauben, es gehe darum, über eine Hauterkrankung zu informieren. Nur, wer in das Impressum scrollt, findet heraus, dass sich hinter dieser „Aufklärungskampagne“ keine Selbsthilfeorganisation verbirgt, sondern ein Pharmakonzern. Galderma wurde 1981 als Joint Venture von Nestlé und L’Oréal gegründet. 2008 wurde ein amerikanisches Unternehmen übernommen, das ein Mittel gegen Rosazea entwickelt hatte: Oracea, Wirkstoff Doxycyclin. In der Folge startete Galderma seine Kampagne „gegen Rosacea“. Pressemeldungen unter Titeln wie „Angst vor einer Knollennase“ oder „Als Alkoholiker abgestempelt“ wurden veröffentlicht. Body shaming in your face.
Gleichzeitig wurde beim Marktforschungsunternehmen Bryter die weltweite Umfrage „Face Values“ in Auftrag gegeben. Teilnehmende wurden in Assoziationstests gebeten, Wörter neben einem Porträtfoto zuzuordnen oder zu verwerfen. Der Test sei speziell entwickelt worden, um Einstellungen und Überzeugungen zu erfassen, die ansonsten aufgrund von „Gruppenzwang und Höflichkeit“ nicht geäußert würden, erläutert der begleitende Bericht. Dabei seien die neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaften zu Entscheidungsprozessen einbezogen worden. Mit dem negativen ersten Eindruck von Menschen mit Gesichtsröte würden Meinungen zum Lebensstil verbunden. Weniger wahrscheinlich wäre, dass sie als Freund oder Freundin in Frage kämen, in einer Beziehung lebten oder nach einem Bewerbungsgespräch angestellt würden. Und sie würden nicht nur als „körperlich minderwertig“ eingestuft, ihnen würden auch weniger positive „nicht-physische Eigenschaften“ zugesprochen.
„Hat die Gesundheit Ihrer Haut wirklich etwas damit zu tun, wie die Menschen Ihre Intelligenz einschätzen oder Ihre Vertrauenswürdigkeit? Unserer Umfrage zufolge, ja.“
Diese Ergebnisse lassen sich auf die Wahrnehmung von Menschen mit anderen sichtbaren Hauterkrankungen übertragen. Wie der Spiegel berichtet, ergab eine aktuelle Untersuchung, die von Forschenden des Brigham and Women’s Hospital in Boston, Massachusetts, der Yale School of Medicine und weiterer Universitäten durchgeführt wurde, dass jungen Menschen mit Akne im Alltag massive Vorurteile begegnen. Für ihre Untersuchung wurden vier Stockfotos von normschönen Modellen, zwei Männer und zwei Frauen, digital bearbeitet, so dass die Abgebildeten auf zwei weiteren Bildern auch mit leichter sowie mit schwerer Akne zu sehen waren.
In einer Onlinebefragung wurden die Bilder der Modelle mit und ohne Akne über 1.300 Teilnehmenden gezeigt. Die Ergebnisse belegen „erschreckende Diskriminierung“, wie der Spiegel schreibt, im Vergleich zu ihren Originalbildern „mit reiner Haut“ schnitten die Modelle mit schwerer Akne bei zahlreichen Aussagen deutlich schlechter ab. Die Befragten wollten signifikant seltener mit erkrankten Personen befreundet sein und waren seltener bereit, ihnen einen Job anzubieten. Sie schätzten sie als unattraktiver und weniger hygienisch als weniger intelligent und vertrauenswürdig ein. Zusätzlich spielte Rassismus eine Rolle. Bei Schwarzen Modellen wirkte sich die Akne noch negativer auf die Wahrnehmung der Studienteilnehmenden aus.
Bezeichnend ist, wie der Spiegel die Handlungsempfehlung der Studie zusammenfasst. Es sei wichtig, dass Betroffene therapiert würden, um die „negativen Auswirkungen dieser stigmatisierenden Einstellungen zu verhindern“, heißt es. Was gekürzt wurde: Der wiederholte Hinweis der Forschenden, dass die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, Ansätze zum Abbau diskriminierender Haltungen, auch gegenüber Menschen mit sichtbaren Hauterkrankungen, zu entwickeln.
***
Die Galderma-Kampagne „Aktiv gegen Rosacea“ reduziert Menschen, die Rosacea haben, auf ihre Hautrötungen. In der Patientenbroschüre werden Ausschnitte in Großaufnahme gezeigt: Grobporige Nasen, gerötete Augenlider, Pusteln auf der Wange. Demgegenüber stehen strahlend weiße, normschöne Modelle, die den Arzt besuchen, Pflegecreme auftragen, Strandurlaub machen. Der „Behandlungsansatz CLEAR“ stellt „vollständige Erscheinungsfreiheit“ in Aussicht. Nur, wenn Rosacea-Symptome komplett abheilten, könnten sich Menschen im wahrsten Sinne des Wortes „in ihrer Haut wieder wohlfühlen“.
„Wenn Erkrankung und Unreinheit immer wieder in einen Zusammenhang gestellt werden, wenn ‚ein gepflegtes Äußeres‘ nur gesunden Menschen zugesprochen wird, dann macht das natürlich etwas.“
Die Kulturwissenschaftlerin Dr. Elisabeth Lechner forscht an der Universität Wien zu Feminismus, Schönheitsarbeit und Body Shaming. Es sei nichts Ungewöhnliches, sagt sie, dass Produkte über Beschämung, Unsicherheit und Angst vor Diskriminierung verkauft würden. Mit Blick auf Skin Care würden Stereotypisierungen in eine Marketinglogik übersetzt, immer neue Problemzonen erfunden. Was sie als Kulturwissenschaftlerin vor allem kritisiere, sei das hemdsärmelige Heranziehen von evolutionsbiologischen Zugängen, die immerwährende Konstanten und genetisch eingeschriebene unveränderliche Präferenzen ins Rennen führen. „Wie Menschen wahrgenommen werden, hat viel mit ihrer Sozialisation und medialen Darstellung zu tun“, so Lechner. „Wenn Erkrankung und Unreinheit immer wieder in einen Zusammenhang gestellt werden, wenn ‚ein gepflegtes Äußeres‘ nur gesunden Menschen zugesprochen wird, dann macht das natürlich etwas.“ Die Frage, was ist vorzeigbar, wer schön, sei der kapitalistischen Logik unserer Gesellschaft eingeschrieben. Haut werde uns in ihrer medialen Vermittlung als makellos vorgeführt: vermarktbar, haarlos, glatt.
Diese Marketinglogik schließt Menschen mit Hauterkrankungen selbst dann aus, wenn sie direkt adressiert werden sollen. Und das gilt nicht nur für die Pharma- und Kosmetikindustrie. Auch in Bildungsangeboten von Krankenkassen und Verbänden für Menschen mit Hauterkrankungen werden regelmäßig Symbolbilder von normschönen Models genutzt, die Symptome werden anschließend mit Photoshop aufgetragen. Gern schöne glatte rote Kreise, um Krankheit zu abstrahieren. Dies wirkt wie das Reverse Engineering der Arbeit von Porträtfotograf*innen, die jeden Tag Gesichter glätten und Hautauffälligkeiten verschwinden lassen, eine Praxis, die mittlerweile als Bias in Smartphone-Kameras und Bildbearbeitungssoftware verbaut ist.
Dieses Reverse Engineering wurde bezeichnenderweise auch in den Studien von Bryter und der Yale School of Medicine genutzt. Den Teilnehmenden wurden eben keine echten Menschen mit Akne oder Rosacea gezeigt, sondern normschöne Menschen, die nachträglich mit Hautauffälligkeiten versehen wurden.
***
„Jetzt verstehen wir also, warum die Haut von Rosacea-Patientinnen und Patienten in dieser Geschwindigkeit bewertet wird“, schließt der Bericht Face Values, „sie wird als abnormal angesehen.“ Nur, warum? Wenn bis zu 10 Millionen Menschen in Deutschland Rosacea haben – und weltweit geschätzte 415 Millionen, wie die Galderma-Kampagne festhält – warum stocken Studienteilnehmende, wenn sie ein Bild von einer Person mit Rosacea sehen?
Die Antwort liegt auf der Hand: Stockfotos von Person mit Hautrötung sind etwas Ungewöhnliches. Wenn wir Menschen mit Hautauffälligkeiten in den Medien sehen, dann häufig in dramatischen Ausschnitten, unnatürlichen Körperhaltungen, mit gekrümmten Fingern. Kurz, in Darstellungen, die sagen: DAS IST NICHT NORMAL!
Die spannende Frage ist: Warum sehen wir so selten Fotos in den Medien, die gerade junge Menschen mit Hautauffälligkeiten so zeigen, wie sie uns jeden Tag begegnen – auf dem Weg zur Schule, beim Sport, Händchen-Haltend im Park? Warum haben die Teenies in Teenie-Serien keine Akne – außer sie sollen als Loser gekennzeichnet werden? Und ist es tatsächlich erschreckend, dass jungen Menschen unterstellt wird, sie seien „unhygienisch“, wenn ihre erkrankte Haut im Spiegel „reiner Haut“ entgegengestellt wird?
„Warum sehen wir so selten Fotos in den Medien, die gerade junge Menschen mit Hautauffälligkeiten so zeigen, wie sie uns jeden Tag begegnen – auf dem Weg zur Schule, beim Sport, Händchen-Haltend im Park?“
Hinter Kampagnen wie Face Values stecken geballte Ressourcen aus Marketing und Wissenschaft. Influencer und gemeinnützige Initiativen, betont Elisabeth Lechner, seien Hasskommentaren und Bodyshaming schutzlos ausgeliefert. Sie halten den Kopf hin. Deshalb seien Vernetzung und Bündnisse so wichtig.
Mit Sick People wollen wir uns dafür einsetzen, dass neue Bildsprachen entwickelt werden – in Marketingkampagnen, Fernsehserien, Zeitschriften und sozialen Medien. Dem steht eine Industrie der Abwertung entgegen, die von Verunsicherung und Marginalisierung chronisch kranker Menschen profitiert. Diese paradoxe Situation, in der die gleichen Unternehmen, die Diskriminierung dokumentieren, sie gleichzeitig durch ihre Bildsprache reproduzieren, muss durchbrochen werden.
Wenn wir unsere Wahrnehmung von Hauterkrankungen verändern wollen, brauchen wir eine Transformation der visuellen Kultur – weg von der Darstellung als „abnormal" hin zu einer inklusiven Repräsentation, die die Vielfalt menschlicher Haut als selbstverständlich anerkennt. Eine Kultur, die nicht nur den Face Value von Personen in den Blick nimmt, sondern ihre Körper als Teil vielschichtiger Identitäten zeigt und anerkennt. Und das Schöne ist, dafür brauchen wir euch! Wir starten diese Initiative bewusst mit Illustrationen, weil wir den Weg zu einer inklusiven Fotografie gemeinsam gehen wollen.
Ihr habt Interesse, an einem inklusiven, fairen Fotoshooting teilzunehmen?
Schreibt uns an hey@sickpeople.de.
Quellen:
Face Values: Global Perceptions Survey Report by Dr. Simon Moore, Galderma & Act on Red
„Face Value“. In Cambridge Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press & Assessment, 2025. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/face-value#google_vignette.
Lechner, Elisabeth. Riot, don’t diet! Aufstand der widerspenstigen Körper. Wien: Kremayr & Scheriau, 2022.
Shields, Ali, Michael R. Nock, Sophia Ly, Priya Manjaly, Arash Mostaghimi, und John S. Barbieri. „Evaluation of Stigma Toward Individuals With Acne“. JAMA Dermatology 160, Nr. 1 (1. Januar 2024): 93. https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2023.4487.
Hackenbroch, Veronika. „Neue Studie zeigt massive Vorurteile gegenüber Menschen mit Akne“. Der Spiegel, 6. Dezember 2023, Abschn. Gesundheit. https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/akne-pickel-dermatologie-neue-studie-zeigt-massive-vorurteile-gegenueber-menschen-mit-unreiner-haut-a-9d0fd44e-c7c8-4476-8af9-8dc6604aeeb0?sara_ref=re-xx-cp-sh.